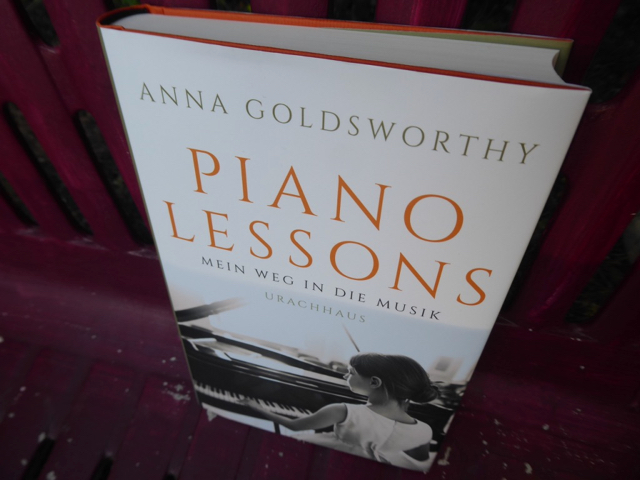(Petra Busch)
1. Warum schreibst Du Biografien für andere Menschen?
Das hat mehrere Gründe. Zum einen ist es Teil meiner Arbeit als Journalistin und Texterin. Ein wunderschöner Teil! Der ist unglaublich spannend. In ein anderes Leben eintauchen, gemeinsam alte Erinnerungen aufspüren, zuhören, Fragen stellen, schließlich aus dem Gehörten ein Buch schreiben: Das ist Leben pur.
Zum andern geraten Lebenserinnerungen in unserer Zeit viel zu schnell in Vergessenheit. Oder es gibt erst gar keinen Platz für sie. Was wissen wir denn über unsere Urgroßeltern und Großeltern? Über ältere verstorbene Freunde? Ich erlebe es in meiner Arbeit als ehrenamtliche Hospizhelferin tagtäglich, dass nach dem Tode eines Menschen die Angehörigen merken: Wir haben die Oma eigentlich gar nicht gekannt. Wir haben den Opa nie nach seinen Träumen gefragt. Uns nie dafür interessiert, wie die Tante mit den neun Kindern sich wirklich gefühlt hat. Solche Dinge. Das macht Kinder und Enkel oft hilflos und manchmal auch unversöhnlich. Den „Schatz“ persönlicher Lebenserinnerungen zu bewahren, kann da Brücken bauen. Kann trösten. Und zum Lachen bringen. Das motiviert mich – und es macht unheimlich Spaß. Und ganz nebenbei bringt es auch Geld. :)
2. Musst Du die Menschen persönlich treffen, für die Du eine Biografie schreibst? Oder genügt Telefonieren, Mailen usw.?
Wer Biografien schreibt, muss sein Gegenüber gut kennenlernen, seine Gestik, sein Lachen studieren, ihm in die Augen sehen. Zwischen den Worten lesen. Oft geht es auch darum, verschüttetet Erlebnisse wachzurufen. Oder dem andern „kleine Geheimnisse“ zu entlocken. Zusammen füllen wir die „Schatztruhe des Lebens“ mit all den kleinen und großen Begebenheiten, die ein Leben so einzigartig machen. Das geht nicht am Telefon oder per E‑Mail.
Meistens besuche ich die Menschen in ihrem Zuhause. In vertrautem Umfeld erzählt sich’s nämlich leichter. Und natürlich kommt dann auch bald der Moment, in dem jemand vom Kaffeetisch aufsteht und das Fotoalbum aus dem Eckschrank holt. Oder den Schuhkarton, in dem die Manschettenknöpfe des Papas neben dem Ehering der Cousine und einem Haarbüschel der Schwester liegen. Dann weiß ich: Die nächsten Stunden entführen mich in ein fremdes Leben. Ich höre von glücklichen Jahren und bitteren Tagen, von Abschieden, beruflichen Erfolgen und Enttäuschungen, Kindern, Enkeln und auch von Begegnungen mit Krankheit und Tod. Von den Dingen, die jemanden zu dem Menschen gemacht haben, der er heute ist.
Natürlich stelle ich zwischendurch immer wieder Fragen, muss das auch „kanalisieren“, auch mal eine Tempopackung über den Tisch schieben. Oder wir besuchen zusammen einen Ort von besonderer Bedeutung: ein Café, ein Museum, die Bank vor der Kirche, wo jemand das erste Rendezvous mit der Liebe seines Lebens hatte. Da sprudeln die Erinnerungen nur so. Oder ein Mensch verstummt plötzlich. Auch das habe ich schon erlebt. Es sagt mindestens genauso viel wie tausend Worte – und fließt auch in die Biografie ein.
Wenn ich alle Infos zusammen habe, viele Stunden mit den Menschen verbracht, schreibe ich. Die Kunden erhalten immer wieder die aktuellen Texte zwecks Diskussion. Das kann dann natürlich per Mail geschehen – falls die Kunden, oft ältere Menschen – mit den Bequemlichkeiten moderner Errungenschaften vertraut sind.
3. Was ist, wenn die Chemie zwischen Dir und Deinem Biografie-Kunden nicht stimmt?
Glücklicherweise ist mir das noch nie passiert. Natürlich gibt es Menschen, mit denen ich bei der ersten Begegnung warm werde. Bei anderen dauert es länger, manche vermitteln mir bis zum Schluss das Gefühl innerer Distanz.
Meine Biografie-Kunden sind zwischen 60 und 95. Viele sind herzlich, lebenslustig, besitzen eine tolle Ausstrahlung und sind am Leben und der Gesellschaft interessiert. Selbst bei bewegenden Schicksalen. Das beeindruckt mich immer wieder. Dann gibt es aber auch die Sorte, die ihr Alter als Freibrief fürs Immer-im-Recht-sein sieht. Bei der alles exakt so funktionieren muss, wie sie es sich jetzt gerade in den Kopf gesetzt hat. Und zwar sofort. Weil die Welt sich nur um sie dreht. Ich versuche dann, mich einfach als Profi zu sehen, mir zu sagen: Das ist Dein Kunde. Der ist König. Die Schwierigkeit ist dabei, eine solche Biografie authentisch umzusetzen. Diesen problematischen oder verbitterten Menschen mit seinen Worten über sein Leben sprechen zu lassen. Ohne als Biografin etwas zu werten, ohne eine ironische Spitze zu hinterlassen. Ich glaube, es ist mir bisher immer gelungen.
Wenn die Chemie einmal ein wirklich explosives Gemisch wäre? Zuerst würde ich das offen ansprechen. Könnten wir nicht klären, was zwischen uns steht, dann hinge mein weiteres Verhalten von unserem Vertrag ab. Wenn möglich, würde ich den Auftrag an eine Kollegin vermitteln. Vielleicht käme der Kunde mit jemand anders besser zurecht?
4. Wie aufwendig ist das Biografieschreiben?
Sehr. Ich investiere viele Wochen für ein Biografie-Projekt. Alleine die Gespräche beanspruchen mehrere Tage. Vorab und auch in der Schreibphase. Natürlich hängt der Aufwand auch vom gewünschten Textumfang ab. Doch ich muss ein Leben von der Geburt bis heute kennen, um auswählen zu können, Schwerpunkte vorzuschlagen. Nicht selten werden Erinnerungen zunächst als wichtig bewertet, und wenn wir dann genauer hinsehen zusammen, tauchen plötzlich Dinge auf, denen eine viel größere Bedeutung zukommt. Auch das kostet Zeit, denn wir müssen umstellen.
Übrigens ist auch für den Kunden ein solches Projekt sehr aufwendig: Vieles Vergessene drängt wieder ins Bewusstsein. Vieles wird aufgewühlt. Und vieles wird auch nach vielen Jahren erst verstanden und aus einem neuen Blickwinkel gesehen.
5. Wie viel von Dir steckt in den Biografien, die Du für andere schreibst?
Hoffentlich nichts – außer gutem Handwerk. Sprich: einem fehlerfreien, lebendig formulierten Text. Autobiografien für Andere zu schreiben heißt ja, in die Rolle der Ghostwriterin zu schlüpfen. Deswegen passe ich mich beim Schreiben dem Erzählstil und der Wortwahl der Menschen an. Eine Biografie muss authentisch sein, das Wesen eines Menschen einfangen. Die Leser wollen „ihren“ Erzähler im Text finden, die Stimme des Vaters oder der Großmutter förmlich hören. Darüber freuen sie sich genauso wie über das Erzählte selbst. Und sie erhalten eines der wertvollsten Dingen, die man sich wünschen kann: eine Wissensquelle rund um die eigenen Wurzeln und Familientraditionen. Gleichzeitig halten sie ein Stück spannende Zeitgeschichte in Händen. Darin habe ich als Biografin nichts zu suchen. ;-) Schließlich steht auch nicht mein Name auf dem Buch, sondern der des Erzählers – oder der Erzählerin.
Petra Busch im Netz: Blog und Texte für Menschen.